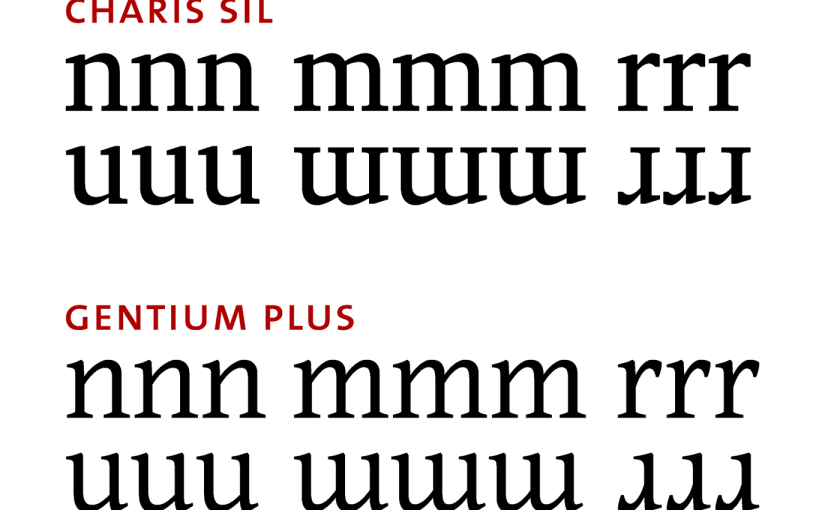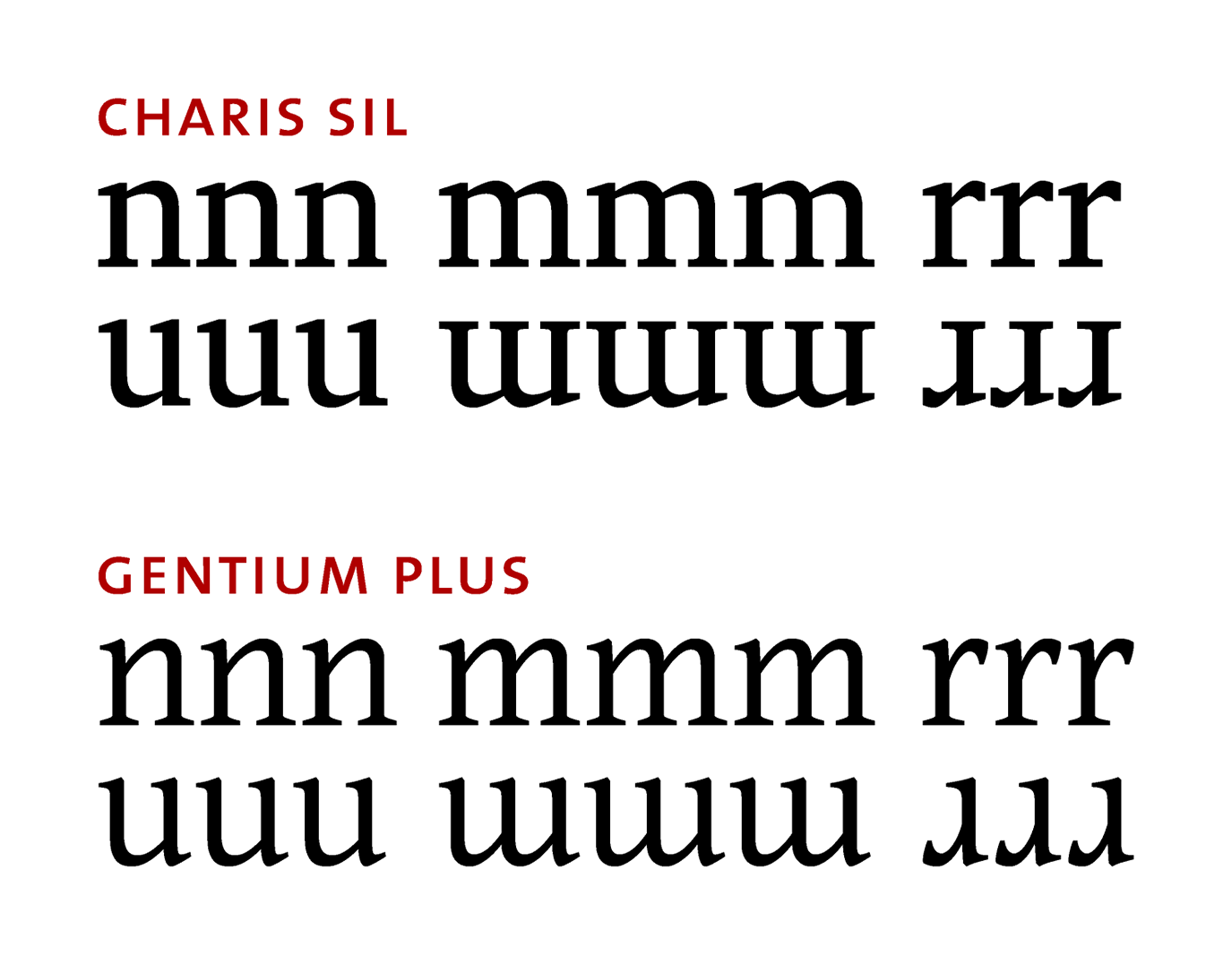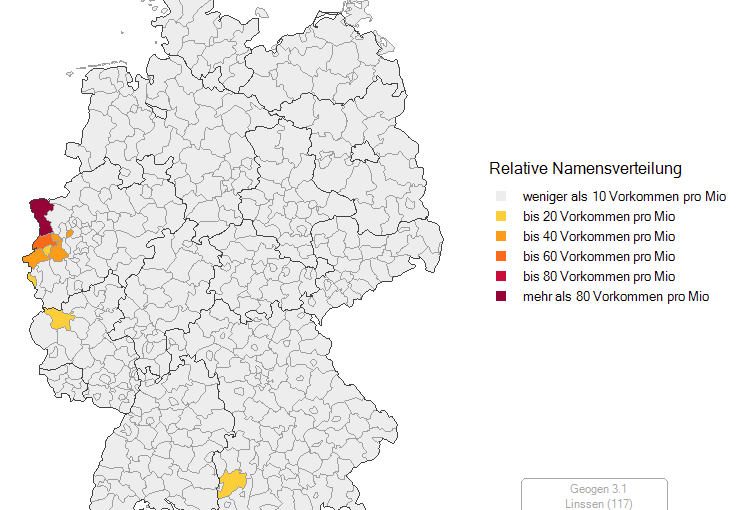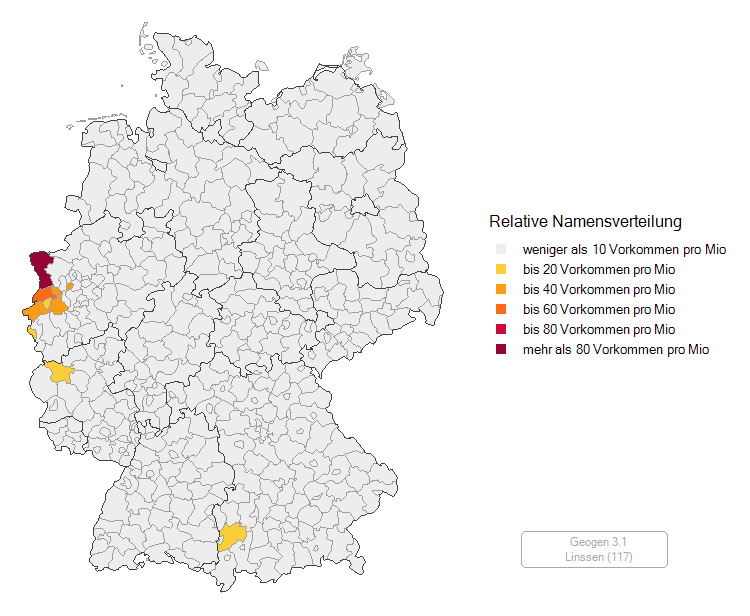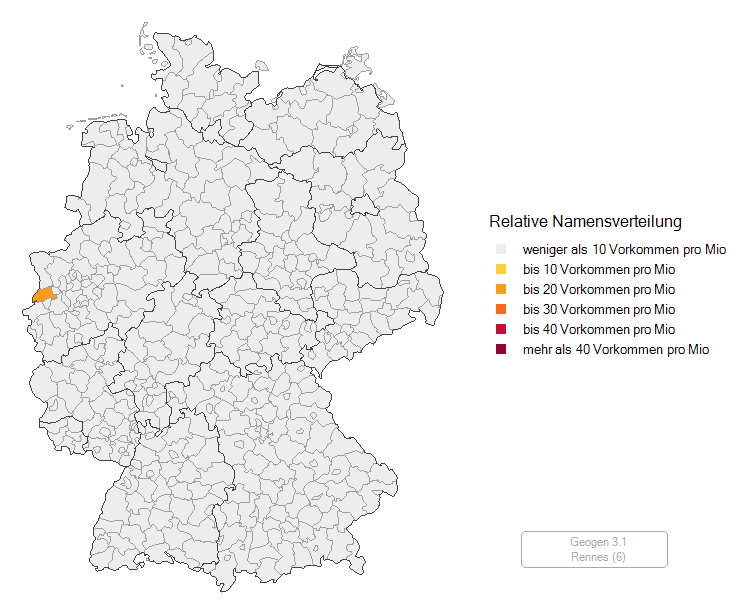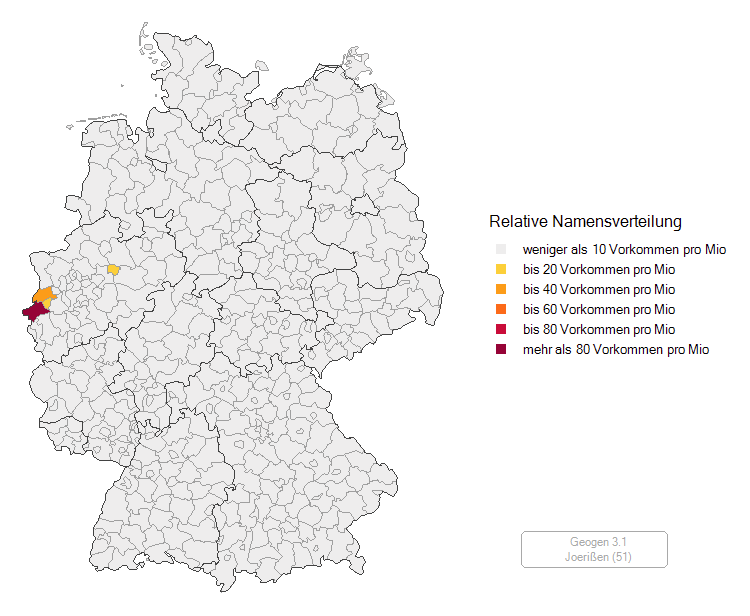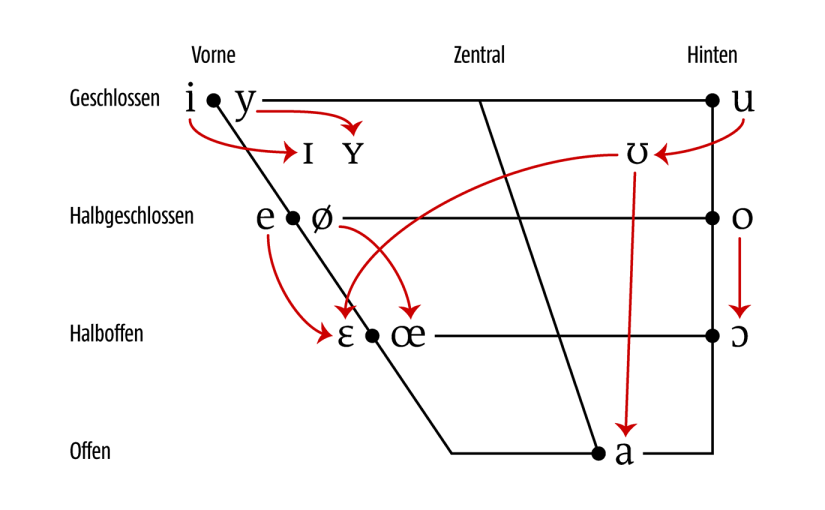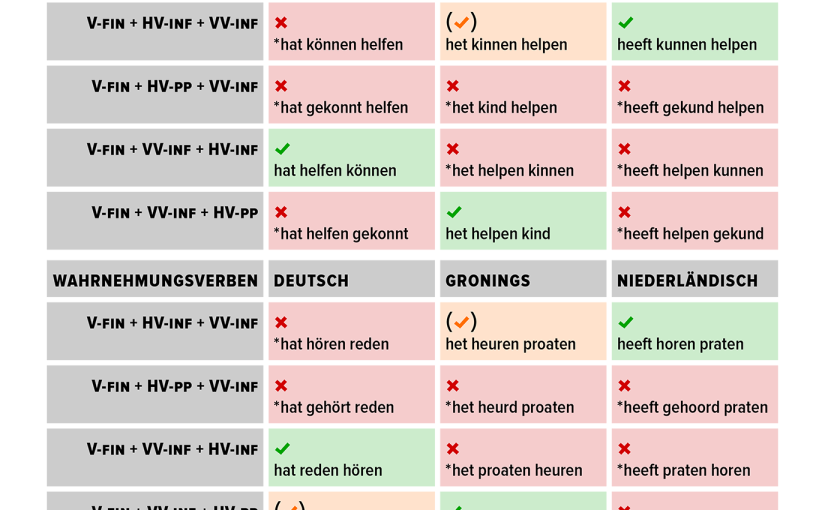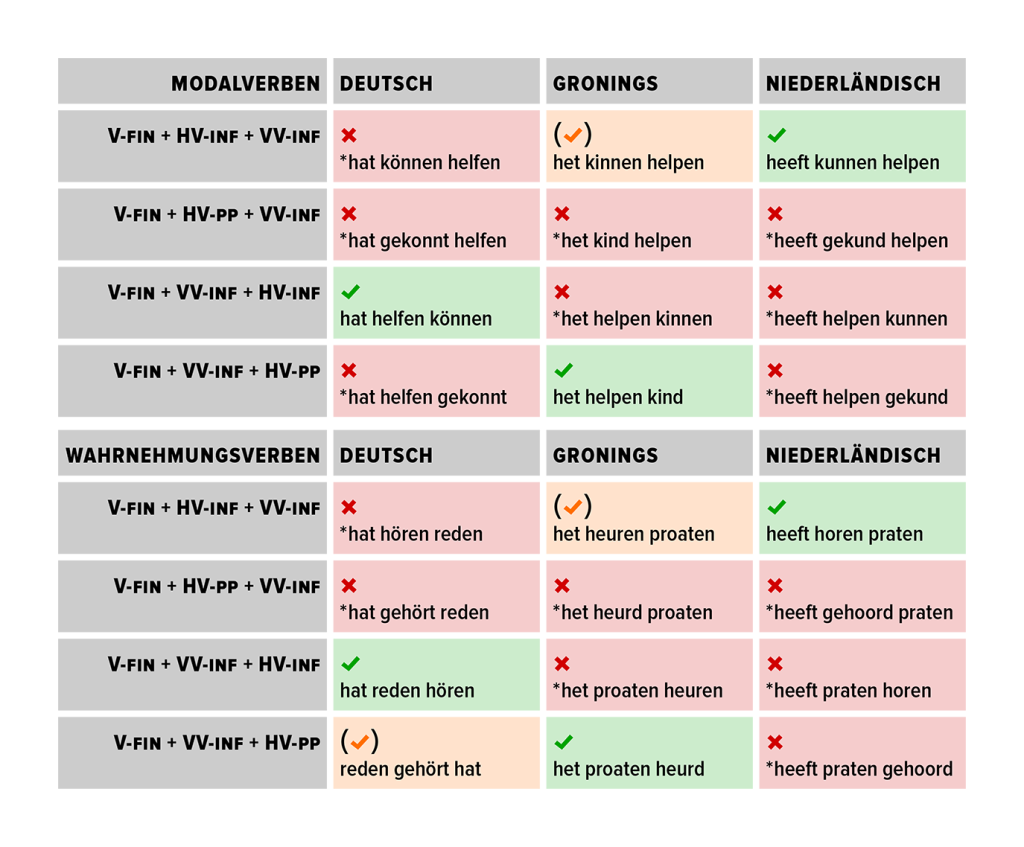In mijn blogpost van 19 april heb ik op een terloopse manier verwezen naar een tekst van Eltje Doddema met de titel “Oremus of de wizzel noar de toukomst”. Met slechts een paar woorden heb ik geprobeerd om samen te vatten waarvoor Doddema in zijn tekst pleit en waarom ik van zijn voorstel niet overtuigd ben. Misschien heeft mijn (ver)korte samenvatting zijn proposities niet helemaal recht gedaan want Doddema zelf plaatste het volgende commentaar op deze site (waarvoor dank):
U schrijft dat ik „een geplande verandering naar het Nederlands toe“ voorsta, echter dit is anders dan de insteek welke ik kies nl. „zo stoef meugelk bie t Nederlands blieven“
Het lijkt me de moeite waard om zijn ideeën nog eens nader te bekijken. Het is een interessante kwestie hoe bovenregionale (streek)taalvariëteiten überhaupt ontstaan. Niet minder interessant zou het antwoord op de vraag zijn of en, zo ja, hoe dit soort ontstaansprocessen aangezet of beïnvloed kunnen worden zodat een standaardisering kan plaatsvinden. Maar laten we allereerst nog eens kijken naar wat Eltje Doddema over het Algemain Beschoafd Grunnegers (ABG) schrijft.
Er moet “ain spellen en grammoatikoa kommen” voor het Gronings – deze stelling staat centraal in zijn tekst. Een onoverzichtelijke wirwar van varianten zou “gain nuigen om joe in t Grunnegs te verdaipen” zijn. Als iedereen zich aan zijn eigen Gronings blijft vastklampen, wordt het volgens Doddema alleen maar moeilijker om het dialect te behouden en te leren. Om de belangstelling voor het Gronings aan te wakkeren, zou er een “geschikt aanbod […] dat voldut aan nije standoards” gecreëerd moeten worden. Maar waar haal je zo’n nieuwe standaard vandaan? Doddema stelt voor om “t heft in handen [te] nemen” en de regels van het ABG volgens bepaalde basisprincipes “mit gezond verstand” vast te leggen. Als ik hem niet verkeerd begrijp, zet hij zich er voor in dat de beslissing hoe het ABG eruit zou moeten zien, op een systematische manier en in overleg genomen wordt. Het belangrijkste uitgangspunt is dat voor vormen gekozen moet worden die “zo stoef meugelk bie t Nederlands” staan. De standaardisering voltrekt zich volgens Doddema niet spontaan, maar vereist – naast weloverwogen beslissingen over de nieuwe regels – ook “wil en deurzettensvermogen” van de kant van de voorstanders van het ABG.